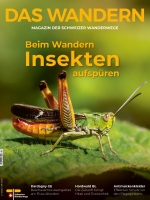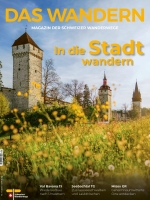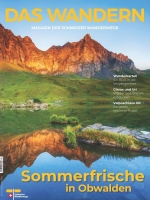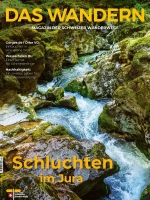Der menschliche Organismus ist darauf angewiesen, die Körpertemperatur von rund 37 Grad Celsius konstant aufrechtzuerhalten. Unabhängig davon ist das Temperaturempfinden eine sehr individuelle Angelegenheit – während es die einen auf der winterlichen Wanderung fröstelt, steht den anderen der Schweiss auf der Stirn.
Die äusseren Umstände tun das ihre dazu. Pfeift uns beispielsweise ein starker Wind um die Ohren, wird unsere Körperwärme förmlich weggeblasen. Die gefühlte Temperatur kann gut und gerne zehn Grad unter der gemessenen Temperatur liegen – man spricht vom Wind-Chill-Effekt. Er wird durch feuchte Kleidung und nasse Haut zusätzlich verstärkt.
Wärme geht ebenso verloren, wenn man beispielsweise auf einem kalten Stein sitzt – sie wandert vom Körper zum Stein. Oder sie strahlt ab – wie ein Heizkörper sendet der menschliche Körper elektromagnetische Strahlung aus. Höchste Zeit also, eine Isolationsjacke überzuziehen.
So funktioniert Isolation
Ziel einer Isolationsjacke ist es, die vom menschlichen Körper produzierte Wärme einzufangen und zurückzuhalten. Dazu werden isolierende Materialien wie Daune, Woll- oder Kunstfaservliese zwischen zwei textile Schichten gepackt. Ihre dreidimensionale Struktur ergibt viele kleine Hohlräume, in der die warme Körperluft eingeschlossen und gespeichert wird. Luft ist ein schlechter Wärmeleiter und isoliert entsprechend gut. Ein dichter Aussenstoff schützt zusätzlich vor Wind und verhindert den Austausch der erwärmten Luft mit der kalten Umgebungsluft. Hersteller Columbia versieht den Futterstoff an der Innenseite mit metallischen Goldpunkten – ähnlich einer Rettungsdecke –, sodass die Körperwärme reflektiert wird.
Kunstfasern: pflegeleicht und schnelltrocknend
In Outdoorprodukten werden häufig Kunstfaser-Vliesstoffe – meist Polyester – verwendet, bei denen Mikrofasern in Wirrlagen miteinander verbunden sind und so winzige Lufttaschen erzeugen. Ein bekannter Hersteller ist beispielsweise Primaloft. Füllungen aus kurzen Kunstfaserstückchen oder Kügelchen, welche die Struktur von Daune nachahmen, werden auch als «künstliche Daune» bezeichnet. Hier gilt: Je kürzer die Fasern sind, umso besser funktioniert der Lufteinschluss. Allerdings können kurze Fasern leichter verrutschen und werden daher in abgesteppte Kammern eingesperrt. Im Gegensatz zu Daune nehmen Kunstfasern kaum Feuchtigkeit auf, kollabieren nicht bei Nässe, trocknen schnell und sind pflegeleicht.
Daune: leicht und komprimierbar
Im Verhältnis zu ihrem Eigengewicht von gerade einmal 0,001 bis 0,002 Gramm pro Stück können Enten- oder Gänsedaunen sehr viel Raum einnehmen. Anders als eine Feder verfügen sie nicht über einen Kiel, sondern breiten sich mit Millionen kleinster Verästelungen von einem kleinen Kern dreidimensional aus. In punkto Packmass und Isolationsvermögen sind sie unschlagbar – solange sie trocken bleiben. Denn der für die Wärmedämmung notwendige Bausch schwindet mit zunehmender Feuchtigkeit. Einige Hersteller imprägnieren ihre Daunen, um sie feuchtigkeitsresistenter zu machen.
Die Qualität von Daunenfüllungen wird durch zwei Faktoren definiert: die Füll- oder Bauschkraft der Daune und das Mischverhältnis von Daunen zu Federn. Üblich ist eine 90/10 Mischung, also 90 Prozent Daune, zehn Prozent Federn. Einen gewissen Anteil an «normalen» Federn braucht es; sie bringen durch die steifen Kiele Struktur in die Füllung.
Der zweite Indikator, die Füllkraft, wird mit der cuin-Zahl (engl. «cubic inch», dt. Kubikzoll) angegeben und beschreibt, wie stark sich die Daune nach Kompression wieder ausdehnt. Je stärker die Füllkraft, desto höher die cuin-Zahl, desto besser ist auch das Gewichts-Isolations-Verhältnis. Gute Füllungen starten bei 600 cuin, Topwerte liegen bei 750 und darüber.
Auch Daunen werden in Kammern eingeschlossen, damit sie nicht verrutschen oder sich nur an einigen Stellen sammeln. Die Nähte der Kammern können jedoch Kältebrücken bilden – Stellen also, wo Wärme verlorengeht. Aufgrund ihrer Struktur sind Daunen besser komprimierbar als Kunstfaservliese, daher haben Daunenjacken meist nicht nur ein geringeres Gewicht, sondern auch ein kleineres Packmass bei gleicher Wärmeleistung.
Wolle als Alternative?
Seit einigen Jahren werden vermehrt auch Faservliese aus Wolle für Isolationsjacken eingesetzt. Pionier war in dieser Produktkategorie der deutsche Hersteller Ortovox, der als erster die Wollwattierung von Swisswool verwendete. Schurwolle ist ein nachwachsender Rohstoff und kann relativ viel Feuchtigkeit aufnehmen und diese bis zu einem gewissen Grad puffern, ohne sich nass anzufühlen. Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Plus: Wolle hat geruchshemmende Eigenschaften.[AI1]
Wolle ist jedoch bei vergleichbarer Wärmeleistung schwerer und weniger gut komprimierbar als Daune oder Kunstfaser.
Wie warm sollte die Jacke sein?
Generell gilt: Je dicker eine Schicht, umso wärmer ist sie auch. Wir fühlen uns wohl, wenn unser Körper im sogenannten thermischen Gleichgewicht mit der Umgebung ist, wir weder schwitzen noch frieren. Logischerweise benötigen wir bei minus 10 °C eine wärmere Jacke als bei plus 10 °C.
Neben dem Aussenklima – bestehend aus Temperatur, Wind und Luftfeuchte – ist die Intensität der Aktivität entscheidend für die Wahl der Jacke. Für anspruchsvolle Winterwanderungen oder Schneeschuhtouren benötigen wir bei gleichen klimatischen Bedingungen eine dünnere Jacke als für den entspannten Spaziergang.
Je geringer die körperliche Aktivität und die Temperatur, desto dicker muss die Jacke gefüttert sein, um den Körper warm, das heisst, bei 37 °C im Gleichgewicht zu halten. Ist dieses Ziel erreicht, bleibt auch die Wanderung durch verschneite Winterlandschaften in bester Erinnerung.